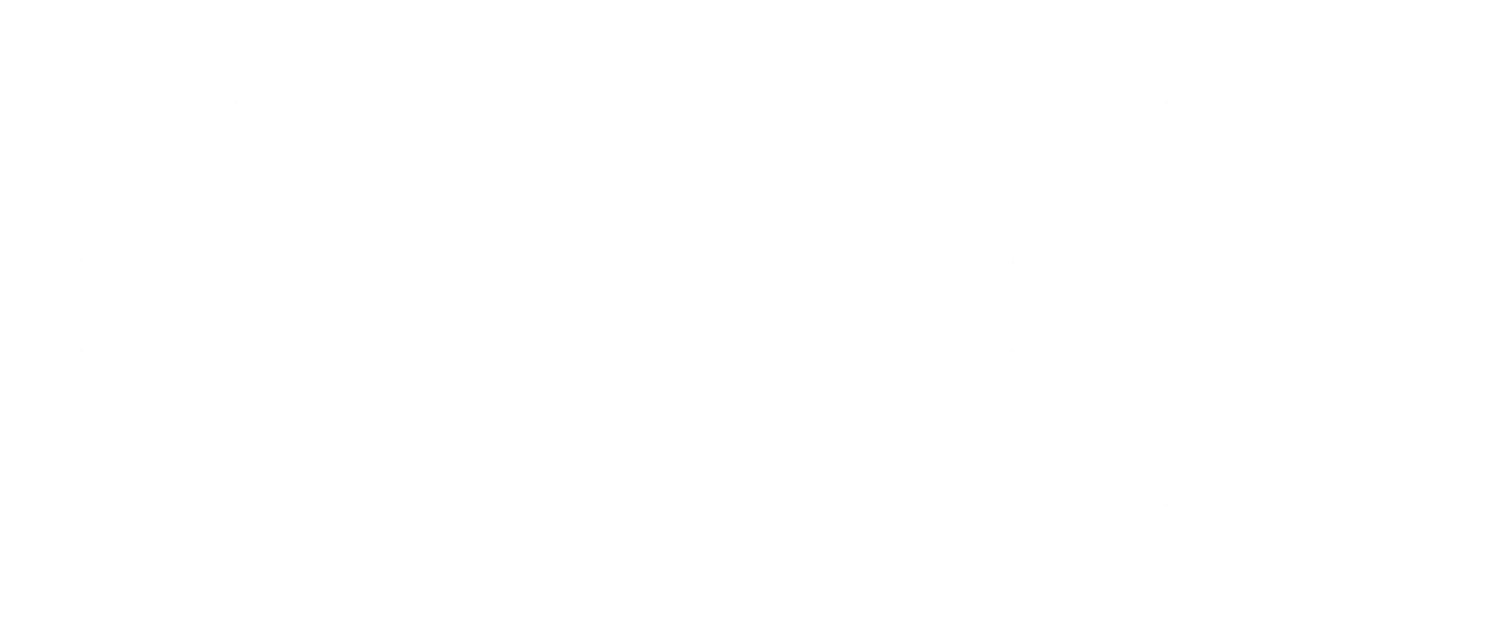Mehr Macht, mehr Geld, weniger Kontrolle? EU-Kommission will Haushalt drastisch erhöhen
Die Europäische Kommission unter der Führung von Ursula von der Leyen hat kürzlich Pläne vorgestellt, den EU-Haushalt für die Jahre 2028 bis 2034 um rund 50 Prozent auf 2 Billionen Euro zu erhöhen. Diese Aufstockung um 700 Milliarden Euro soll vor allem in den Bereichen Sicherheit und Verteidigung zum Tragen kommen – vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen, insbesondere im Osten Europas. Doch der Vorschlag wirft nicht nur finanzpolitische, sondern auch demokratische und strukturelle Fragen auf.
Finanzielle Belastung der Mitgliedstaaten – Deutschland wieder Hauptzahler
Deutschland, als wirtschaftsstärkstes Mitgliedsland, trägt traditionell rund ein Viertel des EU-Haushalts. Es ist absehbar, dass auch diesmal der deutsche Steuerzahler einen erheblichen Teil der zusätzlichen Last schultern muss. Dies geschieht zu einem Zeitpunkt, an dem die Haushalte vieler Mitgliedsländer – auch Deutschlands – stark angespannt sind, die Sozial- und Bildungssysteme unter Druck stehen und viele Bürger unter hoher Inflation und Steuerlast leiden.
Zwar schlägt die Kommission zusätzliche Einnahmequellen vor – wie eine Abgabe für Großunternehmen, eine Elektroschrottsteuer und die Umlenkung von Tabaksteuereinnahmen nach Brüssel –, doch auch diese Maßnahmen führen letztlich zu einer indirekten Belastung der Bürger und der Wirtschaft. Unternehmen werden diese Mehrkosten weitergeben, was die Inflation anheizen und die Wettbewerbsfähigkeit gefährden könnte.
Militär vor Agrar – Ein fragwürdiger Schwerpunkt
Kritisch ist der zunehmende Fokus auf Rüstungs- und Verteidigungsausgaben zu sehen. Während Milliarden für militärische Aufrüstung bereitgestellt werden sollen, laufen Landwirte und strukturschwache Regionen Gefahr, ins Hintertreffen zu geraten. Die Agrarförderung, einst ein Kernbereich der EU-Politik, soll künftig in einem Sammelfonds aufgehen – zusammen mit Strukturhilfen. Dies verwässert nicht nur Förderziele, sondern erschwert die gezielte Unterstützung ganzer Berufs- und Wirtschaftsgruppen.
Dass gleichzeitig weniger Mittel fest verplant werden sollen, um „flexibel auf globale Entwicklungen reagieren zu können“, klingt in der Theorie nach Handlungsfähigkeit – in der Praxis jedoch nach wachsender Haushalts-Intransparenz und politischer Willkür. Was als „Reform“ verkauft wird, bedeutet in Wahrheit eine Abkehr von demokratisch abgesicherten Förderprogrammen.
Rückzahlung des Corona-Fonds – Schulden von morgen
Ein weiterer Teil der Milliarden wird benötigt, um ab 2028 mit der Rückzahlung des Corona-Wiederaufbaufonds zu beginnen – ein beispielloses Schuldeninstrument, das bereits damals heftig umstritten war. Zwar wurde dieser Fonds als Notmaßnahme legitimiert, doch nun wird er zum dauerhaften Haushaltsfaktor, dessen Rückzahlung Generationen beschäftigen wird.
Dass nun erneut ein derartiges Schuldenvolumen ins Spiel gebracht wird – teils zur Finanzierung langfristiger Rüstungsprojekte – verstärkt den Eindruck, dass Brüssel mehr als jemals zuvor zur Schulden- und Umverteilungsunion wird, mit Deutschland als Hauptfinanzier.
Demokratische Kontrolle – das Parlament schlägt Alarm
Besonders brisant ist der Vorschlag, dass künftig nationale Reform- und Investitionspläne (NRPs) darüber entscheiden sollen, wie EU-Mittel verwendet werden. Dies würde die Rolle des Europäischen Parlaments schwächen – genau das kritisieren Fraktionsvorsitzende fast aller großen Fraktionen. Von einer „Renationalisierung zentraler EU-Politiken“ ist die Rede, verbunden mit der Sorge, dass damit die demokratische Kontrolle der Haushaltsmittel untergraben wird.
Ein solcher Schritt wäre eine bedenkliche Machtverschiebung – nicht nur weg vom Parlament, sondern auch hin zu einer technokratischen Kommission, die immer mehr Einfluss auf nationale Politiken gewinnt, aber nur bedingt demokratisch legitimiert ist.
Fazit: Mehr Europa um jeden Preis?
Der Haushaltsvorschlag der EU-Kommission ist Ausdruck eines Trends: Zentralisierung, Aufrüstung und Verschuldung scheinen zunehmend die Pfeiler einer neuen EU-Agenda zu sein. Kritiker sehen darin eine gefährliche Entwicklung: Nationale Parlamente verlieren an Einfluss, der europäische Steuerzahler wird stärker belastet, während große Mittel in undurchsichtige Strukturen fließen.
Statt eine EU zu bauen, die bürgernah, effizient und sparsam handelt, scheint Brüssel eine Union zu fördern, die immer mehr Kompetenzen, Geld und Kontrolle in die eigenen Institutionen zieht. Ob das der richtige Weg ist, Europa zu stärken – wirtschaftlich, sozial und politisch – darf ernsthaft bezweifelt werden.
Empfehlung
Eine breite öffentliche Debatte über den Haushalt ist dringend geboten. Parlamentarische Kontrolle darf nicht geschwächt, sondern muss ausgebaut werden. Zudem sollte eine ehrliche Diskussion darüber geführt werden, welche Aufgaben die EU übernehmen soll – und welche besser auf nationaler Ebene bleiben.