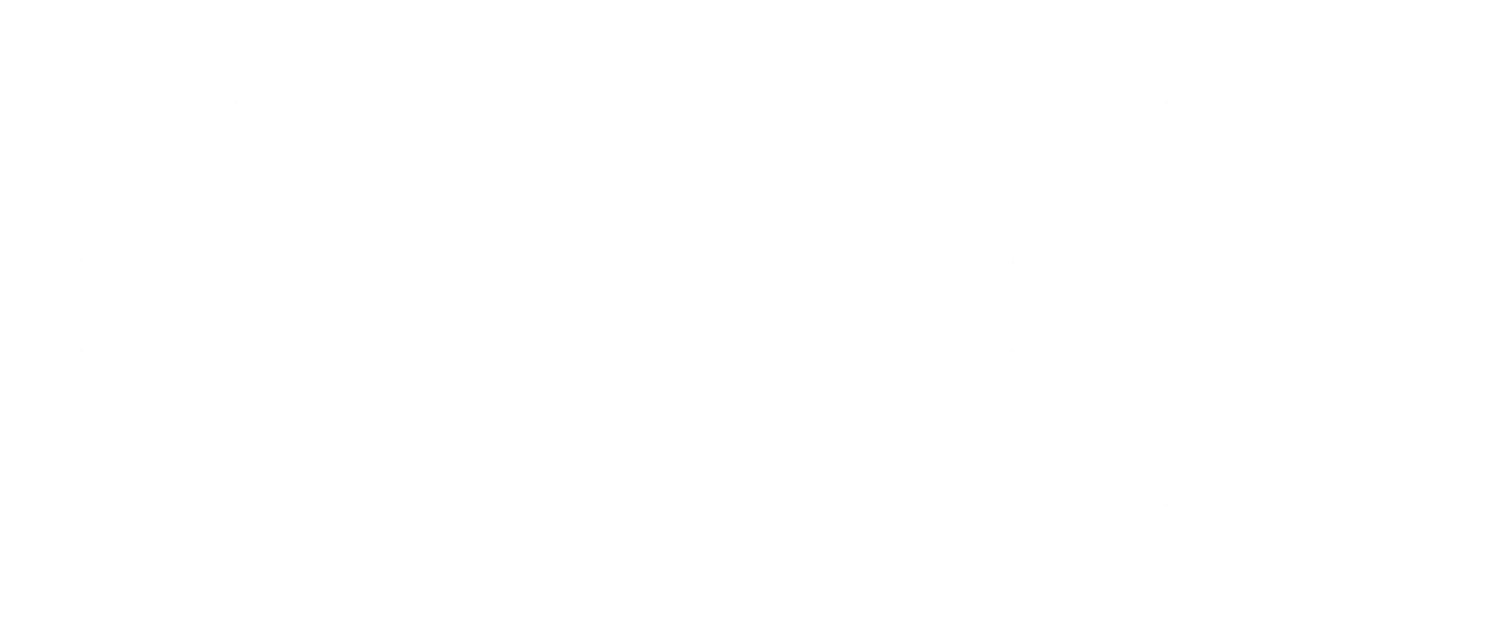Teilzeitdebatte in Österreich: Die Ironie politischer Steuerung – ein Blick hinter den Vorhang!
Die aktuelle Diskussion rund um Teilzeitarbeit in Österreich offenbart mehr als bloß wirtschaftliche Engpässe. Sie zeigt, wie politische Kräfte heute jene gesellschaftlichen Entwicklungen kritisieren, die sie selbst über Jahrzehnte aktiv befördert haben – und sie lenkt den Blick auf ein noch tiefer liegendes Narrativ: die systematische Umgestaltung der Familienstruktur zugunsten wirtschaftlicher Verwertbarkeit des Einzelnen.
Von der Förderung zur Problematisierung: Die ÖVP und das Teilzeit-Paradoxon
Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) warnt aktuell davor, dass zu viele Menschen in Teilzeit arbeiten – insbesondere gesunde Personen ohne Betreuungspflichten. Die Begründung: sinkende Arbeitsleistung, steigende Sozialkosten, Fachkräftemangel. Seine Partei plädiert daher dafür, Teilzeit weniger attraktiv zu machen.
Wolfgang Hattmannsdorfer (ÖVP) / RTV-Archiv
Das Bemerkenswerte daran ist: Genau diese ÖVP, insbesondere unter Wirtschaftsminister Martin Bartenstein (Amtszeit 1995–2007), war eine treibende Kraft hinter der politischen Salonfähigkeit der Teilzeitarbeit. Teilzeit wurde gesetzlich erleichtert und öffentlich als familienfreundliche Maßnahme für Frauen propagiert. Das Ziel: Mütter sollten einfacher berufstätig werden, auch in kleineren Stundenausmaßen.
Hier eine Presseaussendung aus dem Jahr 1997:
https://www.ots.at/presseaussendung/OTS_19971121_OTS0149/familie-und-arbeit-1-bartenstein-fuer-mehr-flexibilitaet
Martin Bartenstein (2003) - Unternehmer und Wirtschaftsminister (ÖVP) von 2000 bis 2008; Bilderbergerteilnehmer in Istanbul 2007
Was damals als Fortschritt gefeiert wurde, hatte jedoch eine tiefere ökonomische und ideologische Dimension: Frauen sollten nicht mehr „nur“ Familienarbeit leisten, sondern in den Arbeitsmarkt integriert werden – als eigenständige Steuerzahlerinnen. Teilzeit war hierfür das ideale Mittel: vereinbar, weich, wirtschaftlich verwertbar.
Aaron Russo und das Rockefeller-Zitat: Eine unbequeme Perspektive
Hier schließt sich der Bogen zu einem der meistdiskutierten Interviews der frühen 2000er-Jahre. Der US-Filmproduzent Aaron Russo, bekannt durch Filme wie “Die Glücksritter”, “The Rose” und "America: From Freedom to Fascism", schilderte in einem Interview, das kurz vor seinem Tod 2007 aufgezeichnet wurde, ein Gespräch mit einem ihm bekannten Nick Rockefeller.
Die beiden standen laut Russo im Zuge seiner politischen Aktivitäten in persönlichem Kontakt. Rockefeller habe in einem offenen Moment Folgendes eingeräumt:
„Wir haben die Frauenrechtsbewegung unterstützt – nicht aus Interesse an Gleichberechtigung, sondern damit wir die Frauen besteuern können und die Kinder den Einfluss der Mutter verlieren. Dann haben wir die nächste Generation in der Hand.“
Dazu ein Youtube-Link:
https://youtu.be/31DPtM3-pio?t=1379
Diese Aussagen – so spekulativ sie erscheinen mögen – passen auf unheimliche Weise in das Bild politisch flankierter gesellschaftlicher Transformation:
Der klassische Einverdienerhaushalt – ein arbeitender Mann, der Familie, Hausbau und Urlaub finanzieren konnte – wurde systematisch durch wirtschaftliche und gesellschaftliche Rahmenbedingungen unter Druck gesetzt. Die Frau, einst tragende Säule der Familien- und Kindererziehung, wurde über Jahrzehnte als „unabhängig“ und „emanzipiert“ definiert – jedoch auf Basis ihrer Integration in den Erwerbsprozess, nicht ihrer familiären Rolle.
Teilzeitarbeit war und ist dabei kein neutrales Angebot, sondern ein Instrument: Es ermöglichte eine sanfte Verschiebung weiblicher Lebensrealitäten, ohne allzu offensichtlichen Bruch. So wurde die Frau schrittweise von der primären Verantwortung für die Familie in die wirtschaftliche Verwertung überführt – mit gesellschaftlichem Applaus, steuerlichen Effekten und kultureller Umdeutung von Rollenbildern.
Und heute? Schuld sind wieder die Bürger
Nun, da die demografische Realität drängt und die Folgen dieses jahrzehntelangen Umbaus sichtbar werden – etwa in Form von Fachkräftemangel, niedriger Pensionsbeiträge oder Überalterung –, wird die Schuld an der Bevölkerung festgemacht: zu wenig Stunden, zu viel Teilzeit, zu wenig Produktivität.
Doch das ist zynisch, denn die Rahmenbedingungen für diese Situation wurden nicht von Einzelpersonen, sondern von Politik, Wirtschaft und Ideologie geschaffen. Wer heute Teilzeit arbeitet, folgt oft dem strukturellen Angebot – nicht dem eigenen Müßiggang. Und wer sich fragt, warum ein Gehalt kaum mehr für eine Familie reicht, sieht die Konsequenz dieser Transformation: Der Doppelverdiener-Haushalt ist zur Norm geworden, nicht zur Option.
Fazit: Steuerpolitik oder Sozialingenieurskunst?
Die aktuelle Teilzeitdebatte ist nicht nur eine wirtschaftspolitische Auseinandersetzung, sondern ein Spiegelbild tiefer gesellschaftlicher Umsteuerung, die bewusst gestaltet wurde – mit klaren Gewinnern: Staat, Wirtschaft, Kontrollstrukturen. Ob man die Aussagen von Aaron Russo und das angebliche Rockefeller-Zitat nun als Verschwörung oder als entlarvende Insideranalyse sieht – sie zeigen, dass die großen gesellschaftlichen Trends selten zufällig entstehen.
Wenn heute jene politischen Kräfte, die einst die Teilzeit förderten, deren Folgen beklagen, dann geht es nicht um Lösungen – sondern um das Verschieben der Verantwortung. Die Frage ist nicht, ob Menschen zu wenig arbeiten. Die Frage ist:
Wer hat entschieden, was und wie viel wir leisten müssen – und zu wessen Vorteil?