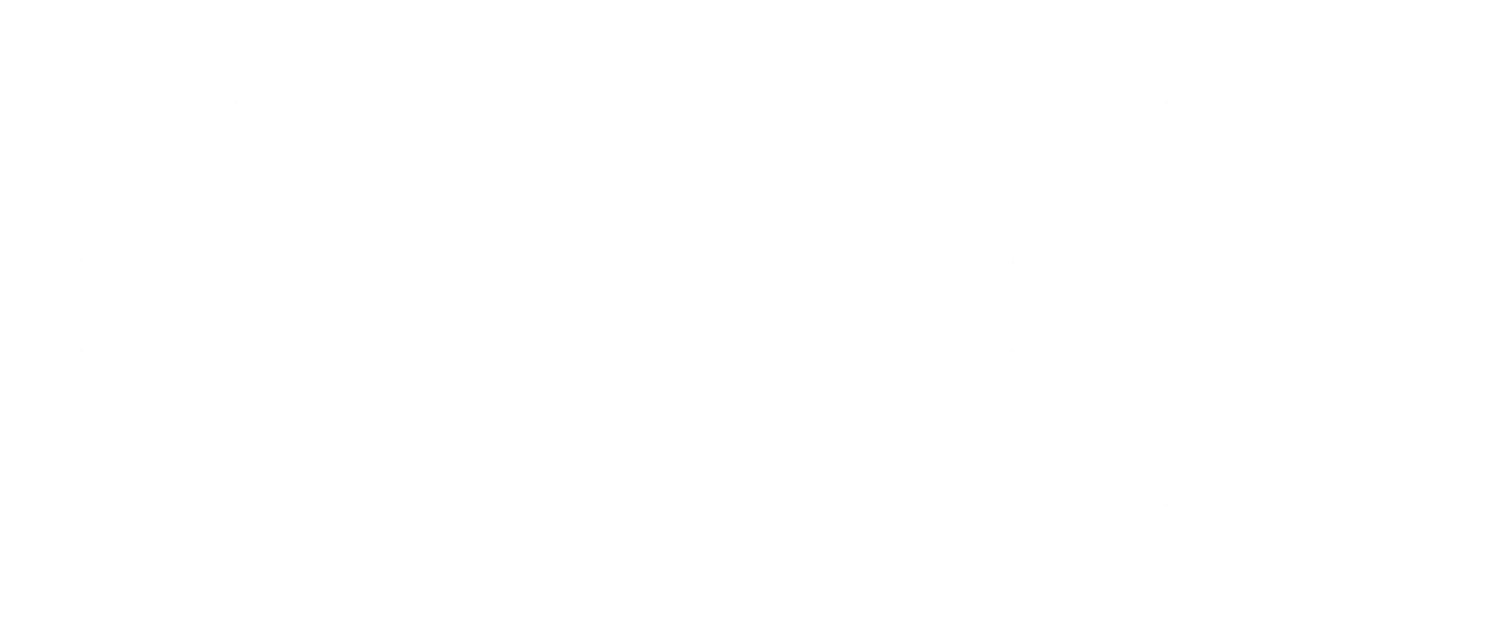ÖH am Black History Month – Antirassismus oder ideologische Exklusion
Die Österreichische Hochschülerschaft (ÖH) an der Universität Wien versteht sich offiziell als Vertretung aller Studierenden, die sich für Gleichbehandlung, freie Bildung und Anti‑Diskriminierung einsetzt – zumindest textlich in ihren eigenen Stellungnahmen und Referaten. Doch im aktuellen Fall des Black History Month offenbaren sich erhebliche Spannungen zwischen dieser Selbstdarstellung und dem tatsächlichen Handeln.
Prinzipientreue vs. praktische Exklusion
Offiziell argumentiert die ÖH, sie wolle durch den Black History Month Rassismus sichtbar machen, solidarische Räume schaffen und historische Kontinuitäten kolonialer Unterdrückung reflektieren.
Das ist in der Theorie ein legitimes Ziel. Doch in der Praxis organisiert die ÖH Veranstaltungen, die formal nur für BIPoC oder „Black Students“ zugänglich sind, also auf Basis von sozial konstruierten ethnischen Gruppen – und somit explizit nicht für „weiße Studierende“.
Kritisch betrachtet steht dies in klarem Widerspruch zum Grundprinzip der Gleichbehandlung aller Studierenden, das die ÖH sonst vehement vertritt – insbesondere dort, wo sie gegen strukturellen Rassismus in Studien, Prüfungen oder Zugängen kämpft.
Indem die ÖH Veranstaltungen nach Hautfarbe oder Selbstbezeichnung selektiert, reproduziert sie faktisch eine Form institutionalisierter Trennung – im Namen der Antidiskriminierung. Dieses Paradox lässt sich nicht durch wohlmeinende Formulierungen über Empowerment oder Schutzräume auflösen.
Einladung aller – aber Zugang für manche?
Ein besonders absurdes Element des aktuellen Vorgehens: Die ÖH hat die Einladungen zu den Veranstaltungen an alle Studierenden verschickt – einschließlich jener, die laut eigener Ausschreibung offiziell gar nicht teilnehmen dürfen.
Das wirkt nicht nur kommunikativ dilettantisch, sondern politisch irreführend: Studierende werden eingeladen, obwohl sie anschließend faktisch ausgeschlossen werden. Das weckt Unverständnis und berechtigte Kritik – vor allem, weil alle über die ÖH einen Pflichtbeitrag zahlen und daher Ansprüche auf gleiche Information und Teilhabe haben.
Selektive Solidarität – ein doppelter Standard
Die ÖH erklärt sich sonst unmissverständlich gegen Diskriminierung und für das Recht auf Bildung – als ein unteilbares, allgemein gültiges Prinzip.
Doch im Kontext des Black History Month liefert die ÖH – bewusst oder unbewusst – ein Beispiel für selektive Solidarität: Sie fordert allgemein gleiche Rechte, aber schafft gleichzeitig exklusive Räume, in denen andere Studierende schlicht keinen Zutritt haben sollen. Diese Praxis kann leicht als Gegenbeispiel zu ihrem eigenen Anspruch auf inklusive Bildungspolitik interpretiert werden.
Politisch wirkt das wie eine Instrumentalisierung antirassistischer Rhetorik für symbolische Identitätspolitik, ohne gleichzeitig eine konsistente, inklusive Hochschulpolitik zu verfolgen.
Empowerment oder neue Spaltung?
Befürworter argumentieren, spezielle Angebote für marginalisierte Gruppen seien notwendig, um Empowerment und Reflexionsräume zu schaffen – Räume, in denen Betroffene frei sprechen und Strategien austauschen können.
Doch dieser Ansatz läuft Gefahr, eine neue Form der Spaltung an der Universität zu schaffen: Statt systemische Strukturen gemeinsam zu analysieren und zu verändern, werden Studierende entlang ethnischer Zuschreibungen segmentiert – nicht nur in der Theorie, sondern im praktischen Eventalltag.
Dabei ist die Frage, ob eine Hochschülervertretung mit dem Mandat aller Studierenden eigene, separierte Räume auf Basis ethnischer Zugehörigkeit schaffen sollte, nicht nur eine akademische Debatte, sondern ein grundsätzliches ethisches Problem.
Image vs. Realität – Glaubwürdigkeit in Gefahr
Für eine Organisation, die sich gegen Diskriminierung einsetzt und für freie Bildung kämpft, ist dieser Vorfall mehr als nur ein organisatorischer Fauxpas. Er wirft grundsätzliche Glaubwürdigkeitsfragen auf:
Kann eine Interessenvertretung für alle Studierenden glaubwürdig Gleichbehandlung vertreten, wenn sie gleichzeitig selektiv ausschließt?
Wird durch solche Praktiken nicht genau das reproduziert, wogegen sie offiziell kämpfen will – nämlich eine Fragmentierung der studentischen Gemeinschaft?
Und welche Wirkung hat eine solche Praxis auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auf dem Campus?
Diese Fragen sind nicht ideologisch oder polemisch – sie betreffen die politische Integrität und Wirksamkeit der ÖH selbst.
Die aktuelle Praxis der ÖH im Kontext des Black History Month ist nicht nur ein kommunikatives Ungeschick, sondern ein politisch problematischer Widerspruch zu ihren eigenen Grundsätzen.
Indem die ÖH Veranstaltungen organisiert, die formell nur bestimmten Gruppen vorbehalten sind, während sie sich gleichzeitig als Vertreterin aller Studierenden versteht, löst sie sowohl interne als auch externe Kritik aus. Diese Kritik ist nicht notwendigerweise gegen antirassistische Anliegen gerichtet, sondern gegen inkonsistentes, selektives Handeln einer Organisation, die für das genaue Gegenteil eintreten will.
Ein ernst gemeinter Antirassismus an Universitäten sollte inklusiv, transparent und auf gemeinsamer Analyse struktureller Probleme beruhen – nicht auf identitätspolitischer Segmentierung, die am Ende der Hochschulgemeinschaft mehr schadet als nützt.