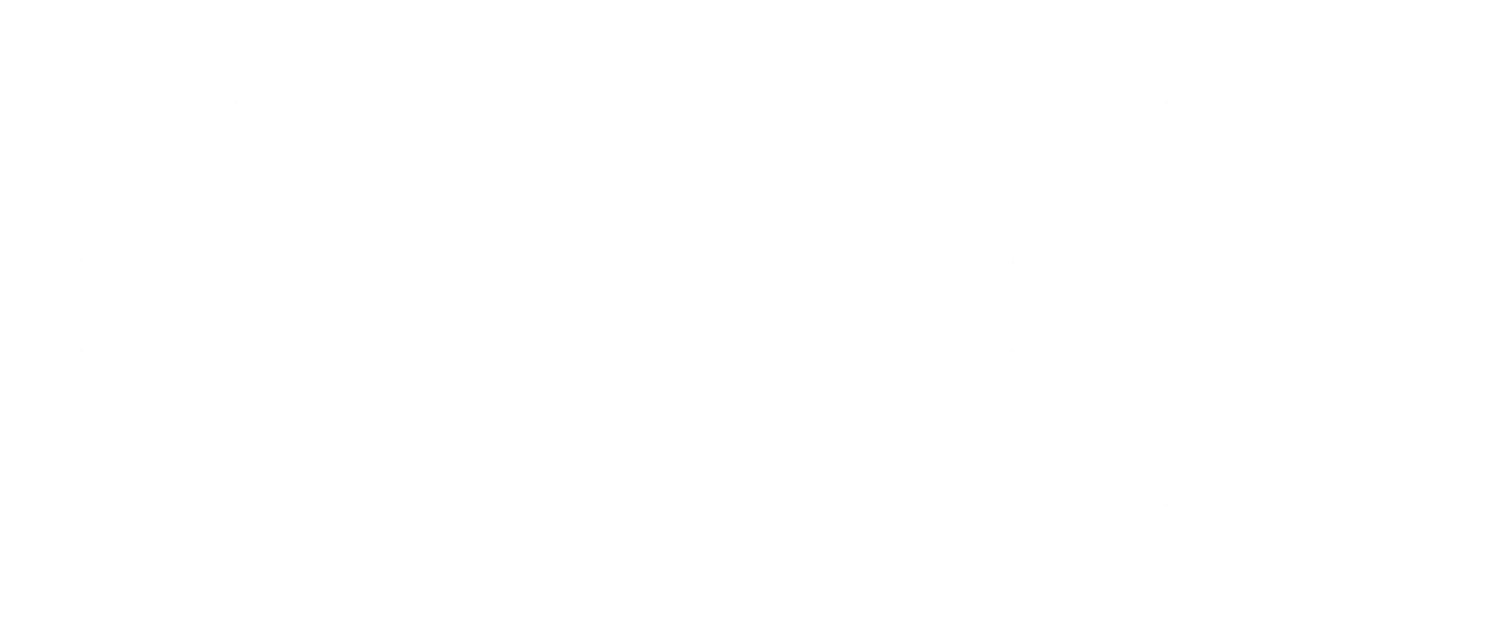Die EU, COP30 und der schmale Grat zwischen Klimaschutz und Zensur
Belém, Brasilien – Auf der UN-Klimakonferenz COP30 in Belém haben mehrere Staaten eine „Deklaration zur Informationsintegrität beim Klimawandel“ unterzeichnet. Die Initiative hat nicht nur Zustimmung, sondern auch kritische Gegenfragen provoziert: Wer bestimmt künftig, was „vertrauenswürdige“ Klimainformation ist?
Was steht in Belém auf dem Spiel?
Die Globale Initiative für Informationsintegrität beim Klimawandel, getragen von Brasilien, den Vereinten Nationen und der UNESCO, brachte auf COP30 eine Deklaration ein, die erstmals die „Integrität von Klima-Informationen“ als globales politisches Ziel verankert. Die Unterzeichnerstaaten – darunter Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Kanada und weitere laut UNFCCC– verpflichten sich zu sechs Säulen: von der Förderung evidenzbasierter Informationen bis zum Schutz von Journalisten und Forscher vor “Angriffen”. Ein zentrales Element der Deklaration ist zudem die Förderung eines resilienten Medien-Ökosystems und der Zugang zu Klimainformationen auf allen Ebenen. Neben staatlichen Verpflichtungen wird die Privatwirtschaft adressiert: Unternehmen sollen transparent werben und Greenwashing vermeiden.
EU-Ambitionen und ihre Schattenseiten
Für die Europäische Union fügt sich diese Deklaration in einen breiteren Regulierungsrahmen ein. Die EU-Kommission sieht „Klimadesinformation“ als eine erhebliche Bedrohung: Laut ihrer Definition handelt es sich um „die absichtliche Verbreitung falscher Informationen über den Klimawandel“, die das Vertrauen in die Wissenschaft untergräbt und demokratische Prozesse schwächt. Zudem verweist die Kommission in ihren Strategien explizit auf Maßnahmen, um Desinformation zu bekämpfen. Kritiker warnen nun, dass diese Zielsetzung in Kombination mit bestehenden Regulierungen – insbesondere dem Digital Services Act (DSA) – eine neue Form der Kontrolle über digitale Plattformen bedeuten könnte. Beobachter wie die Heinrich-Böll-Stiftung weisen etwa darauf hin, dass der DSA noch keine eindeutige Einstufung von „Klimadesinformation“ als systemisches Risiko vorsieht, was zu unklaren Durchsetzungsmechanismen führen kann.
Wo die Gefahr einer Informationskontrolle liegt
So wichtig der Kampf gegen Falschinformationen ist, so kritisch muss betrachtet werden, wer wann, wie und mit welchen Mitteln reguliert:
Begriffliche Breite
„Desinformation“ wird politisch dehnbar verwendet. Es besteht das Risiko, dass legitime wissenschaftliche oder politische Meinungen als unerwünscht diskreditiert werden.Plattformregulierung als Machtinstrument
Wenn Plattformen verpflichtet werden, Inhalte systematisch abzuwerten, zu löschen oder ihre Reichweite zu beschränken, können abweichende Stimmen faktisch zum Verschwinden gebracht werden – ohne staatliche Zensur im klassischen Sinne.Algorithmische Filterung
Bereits jetzt führen Risikoanalysen von Plattformen dazu, dass bestimmte Inhalte weniger Nutzende erreichen. Im Kontext von Klimathemen könnten auch wissenschaftlich kontroverse Inhalte auf diese Weise unterdrückt werden.Internationale Normsetzung
Mit der Deklaration und dem zugehörigen Fonds entsteht eine supranationale “Wahrheitsarchitektur”: Staaten, UN-Organisationen, Zivilgesellschaft und Wirtschaft verhandeln gemeinsam, was als „verlässliche Information“ gilt. Der demokratische Diskurs könnte sich damit stärker um regulierte Narrative zentrieren, statt um offenen Streit.Meinungsfreiheit unter Druck
Auch wenn die Deklaration Freiheit der Meinungsäußerung anerkennt, bleibt die Frage, wie sie im Alltag ausgelegt wird – insbesondere, wenn Regulierungen oder Plattformverantwortung ins Spiel kommen.
Ein zweischneidiges Projekt
Es droht eine gefährliche Dynamik:
Der Kampf gegen differenter Meinung im Zusammenhang mit dem Klimawandel darf nicht in die Regulierung abweichender wissenschaftlicher oder politischer Meinungen umschlagen.
Plattformen dürfen nicht zu Technokraten der Wahrheit werden, die entscheiden, welche Inhalte Bürger noch erreichen.
Staaten, die einmal ein „Informationsintegritäts“-Regime etabliert haben, könnten es gezielt nutzen, um Macht über Narrative auszuüben – nicht zur Förderung, sondern zur Steuerung öffentlicher Diskurse.
Wenn diese Initiative ernsthaft demokratisch und pluralistisch gedacht sein soll, braucht es klare Grenzen, Transparenz und Rechenschaft. Sonst droht aus dem „COP der Wahrheit“ ein Instrument für gesteuerte Demokratie zu werden.