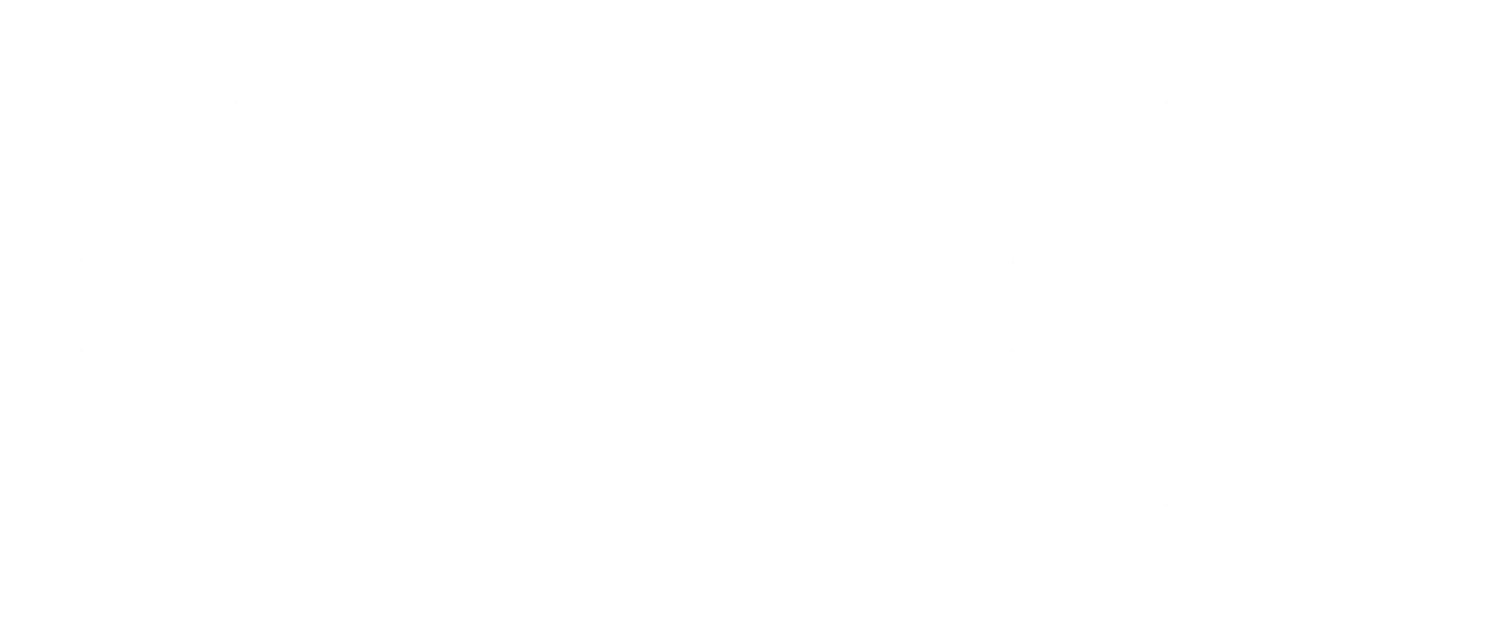Aufhebung der Möglichkeit des geringfügigen Zuverdienstes zum Arbeitslosengeld ab 2026
Im Budgetbegleitgesetz 2025 wird die bisherige Möglichkeit aufgehoben, während des Bezugs von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe einen geringfügigen Zuverdienst zu erzielen.
Ziel der Maßnahme ist laut Bundesregierung, die Ausgaben der Arbeitslosenversicherung zu senken und den Anreiz zur Aufnahme einer vollversicherten Beschäftigung zu erhöhen.
Ausnahmen von der Regelung
Das Gesetz sieht mehrere Ausnahmen vor, in denen ein geringfügiger Zuverdienst weiterhin möglich bleibt (Link Arbeiterkammer):
Fortführung bestehender geringfügiger Beschäftigungen
Wer bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit mindestens ein halbes Jahr geringfügig beschäftigt war, darf diese Tätigkeit fortsetzen, sofern keine Unterbrechung eintritt.Ältere Personen (über 50 Jahre) und Menschen mit Behinderung
Für diese Gruppen bleibt ein geringfügiger Zuverdienst unter bestimmten Voraussetzungen möglich.Langzeitarbeitslose und Langzeiterkrankte
Personen, die bereits länger arbeitslos sind (nach 365 Tagen Bezug) oder über längere Zeit Krankengeld erhalten haben, können weiterhin in beschränktem Ausmaß geringfügig dazuverdienen.
Zahlen zur Betroffenheit:
Ende April 2025 waren laut Arbeitsmarktstatistik etwa 28.120 Personen gleichzeitig im Leistungsbezug nach dem Arbeitslosenversicherungsgesetz (ALVG) und geringfügig beschäftigt.
Das entspricht etwa 7 % der rund 392.000 Jobsuchenden in Österreich (AMS-Daten, April 2025).
Hinweis zur Unsicherheit:
Durch die Ausnahmeregelungen ist nicht bekannt, wie viele dieser 28.120 Personen tatsächlich von der Einschränkung betroffen sind. Die tatsächliche Zahl dürfte geringer ausfallen, da einige Betroffene unter die Ausnahmen fallen.
Finanzielle Annahmen der Regierung
Laut der Wirkungsfolgenabschätzung (WFA) im Budgetbegleitgesetz 2025 rechnet die Regierung mit folgenden Effekten:
Bruttoeinsparung: 133 Mio. €
Begründung: geringere Auszahlungen aus der Arbeitslosenversicherung
Aufwendungen: 22,951 Mio. €
Begründung: Zusatzkosten (Verwaltung, Übergangsmaßnahmen, Anpassungen)
Nettoeinsparung: ≈110 Mio. €
Begründung: erwartete jährliche Entlastung nach Abzug der Aufwendungen
Modellannahme:
Diese Berechnung basiert auf der Annahme, dass bis zu 10.000 Personen weniger Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung beziehen, weil der geringfügige Zuverdienst wegfällt und dadurch die Zahl der Anspruchsberechtigten sinkt.
Unklar bleibt, wie genau sich die ausgewiesenen Aufwendungen von rund 23 Mio. € zusammensetzen. Die WFA nennt Sammelposten (z. B. Verwaltungsaufwand, Anpassungen im Bereich Krankengeld und Umschulungsgeld), jedoch keine detaillierte Aufschlüsselung.
Kritische Analyse der finanziellen Annahmen
Die prognostizierten Einsparungen erscheinen nur bedingt nachvollziehbar:
Damit die erwarteten 110 Mio. € jährlich realisiert werden, müsste die Zahl der Leistungsbezieher tatsächlich um rund 10.000 Personen sinken.
Angesichts der wirtschaftlichen Lage und der hohen Zahl von Langzeitarbeitslosen ist dies zweifelhaft.Die Aufwendungen von rund 23 Mio. € sind in der vorliegenden WFA nicht transparent erläutert; ihre genaue Zusammensetzung bleibt offen.
Es ist zu erwarten, dass Personen, die ihren geringfügigen Zuverdienst verlieren, künftig ergänzende Sozialhilfeleistungen beantragen müssen, was die Einsparungen auf Bundesebene durch höhere Ausgaben auf Länderebene teilweise wieder kompensieren könnte.
Wirtschaftlicher Kontext Österreichs (Stand 2025)
Die Maßnahme fällt in eine wirtschaftlich schwierige Zeit:
Wirtschaftswachstum:
Laut Prognosen von WIFO und OeNB befindet sich Österreich 2025 in einer Stagnationsphase bzw. negativen Entwicklung (−0,1 % reales BIP-Wachstum).Inflation:
Die Jahresinflationsrate lag im April 2025 bei etwa 3,1 % (Statistik Austria).
Besonders betroffen sind Wohn- und Energiekosten.Unternehmensinsolvenzen:
Die Zahl der Firmenpleiten erreichte 2024/25 einen Mehrjahreshöchststand, insbesondere in Bau, Handel und Gastronomie.Arbeitsmarkt:
Trotz leichter Rückgänge bleibt die Arbeitslosigkeit hoch, während die Zahl offener Stellen sinkt.
In diesem Umfeld ist die Annahme, dass der Wegfall des geringfügigen Zuverdienstes automatisch mehr Menschen in Vollzeitbeschäftigung bringt, realwirtschaftlich wenig plausibel.
Soziale und ökonomische Auswirkungen
Einkommensrisiko:
Der geringfügige Zuverdienst war für viele Arbeitslose ein wichtiger Bestandteil zur Deckung der Grundausgaben.
Der Wegfall dieser Möglichkeit kann finanzielle Engpässe verstärken, besonders bei Haushalten ohne weitere Einkommensquelle.Ungleichheit:
Besonders betroffen sind ältere Personen, gesundheitlich Eingeschränkte und Langzeitarbeitslose, die ohnehin geringere Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.Folgewirkungen:
Eine Verlagerung von Kosten in andere Sozialtöpfe (z. B. Sozialhilfe, Mindestsicherung) ist wahrscheinlich.
Das kann die angestrebten Einsparungen des Bundeshaushalts faktisch wieder reduzieren.
Die Aufhebung der Möglichkeit eines geringfügigen Zuverdienstes zum Arbeitslosengeld ist haushaltspolitisch begründbar, aber ökonomisch und sozial umstritten.
Finanzielle Plausibilität:
Die prognostizierten 110 Mio. € Nettoeinsparung beruhen auf Modellannahmen, deren Eintritt angesichts der konjunkturellen Lage unwahrscheinlich ist.Soziale Folgen:
Der Wegfall der Zuverdienstmöglichkeit trifft eine Gruppe, die zu den einkommensschwächsten und arbeitsmarktfernen zählt.Politisch-ökonomische Bewertung:
Kurzfristig mag die Maßnahme das Budget entlasten, langfristig könnten höhere Sozialausgaben und negative Arbeitsmarkteffekte den Nutzen übersteigen.
Gesamturteil:
Die Maßnahme ist fiskalisch nachvollziehbar, aber weder in der finanziellen Kalkulation vollständig transparent noch in der wirtschaftlichen Realität überzeugend. Sie birgt das Risiko, soziale Ungleichheiten zu verschärfen und die Konsolidierungseffekte in der Praxis zu schmälern.